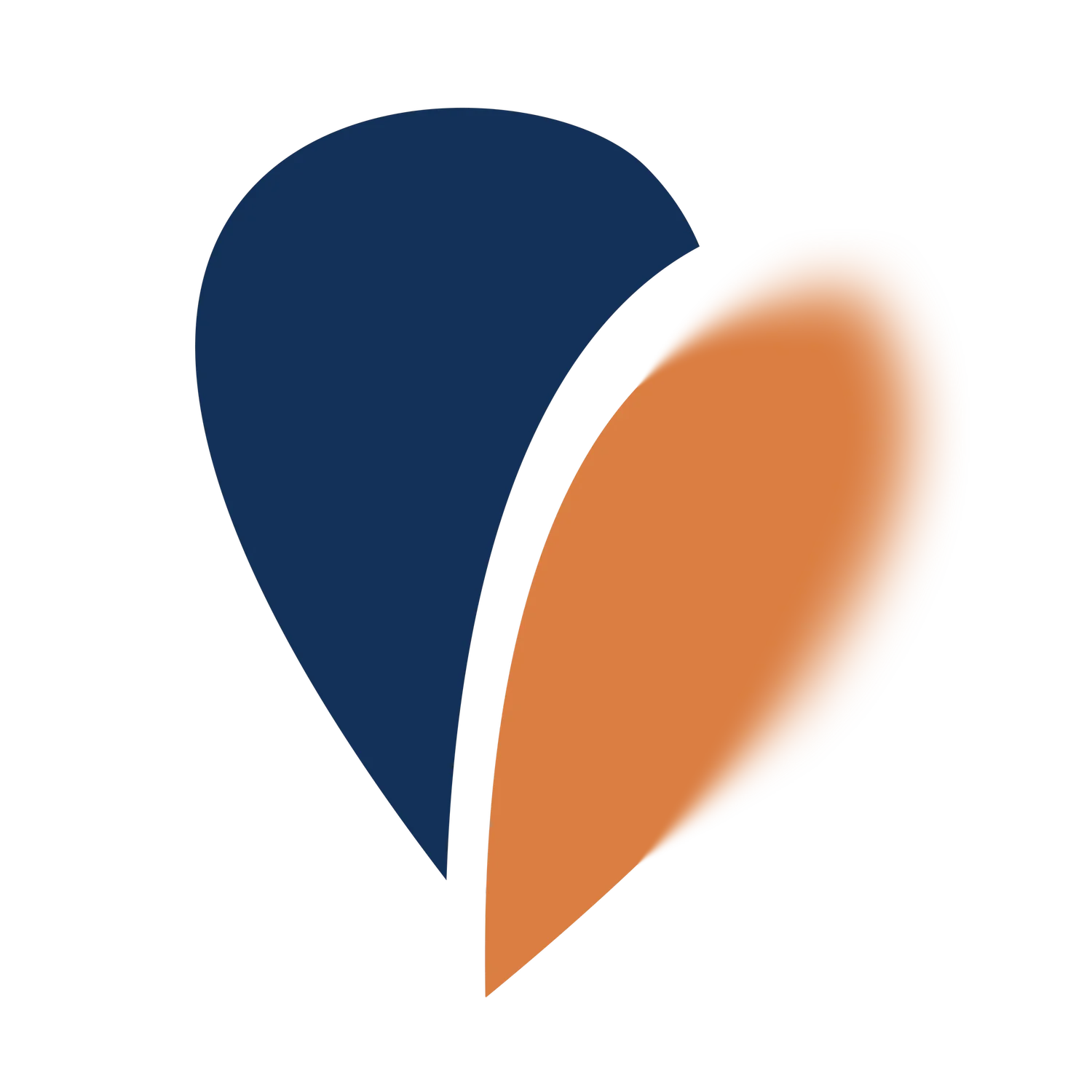Warum Diversität nicht zum Business-Case werden darf
Diversität lohnt sich, Diversität lohnt sich nicht... Haltet euch fest, denn heute fallen Späne!
In der letzten Ausgabe ging es um Culture Fit und Culture Add, denn beide sind wichtig, wenn wir über den bewussten Umgang mit Neurodiversität im Team sprechen. So weit, so gut.
Heute möchte ich diesen Gedanken weiterführen... und mich einer Argumentation widmen, die seit der Erkenntnis von "Oh, es gibt einen Markt zum Thema Neurodiversität" munter ihre Runden dreht. Scheint erstmal superpraktisch für alle, die Diversity irgendwie ihrem Management erklären müssen – langfristig aber äußerst riskant: „Mehr Diversität verbessert die Performance.“
Ja, das liest sich charmant: "Studien zeigen, dass diverse Teams kreativer sind, bessere Entscheidungen treffen, resilienter agieren. Jackpot! Gewinn! Return on Invest, äh, Inclusion!" Aber auch fernab von Moral und Menschlichkeit ist diese Argumentationslinie nicht die Lösung, die sich von ihr erhofft wird.
Die Bedingung hinter dem Versprechen
Was passiert, wenn wir Diversität vor allem mit einem Leistungsversprechen verknüpfen? Es geht sofort um messbare, sich gegenseitig bedingende Ursache und Wirkung. Leider klappt das im echten Leben nicht ganz so einfach und stattdessen schaffen wir unbewusst eine Eintrittsbedingung: Diversität ist nur willkommen, wenn sie messbar „mehr bringt“.
Das tatsächlich wirtschaftliche Problem daran: Wir setzen die Existenzberechtigung marginalisierter Gruppen unter eine Art Probezeit. Bleibt der messbare Effekt aus – oder lässt er sich nicht kurzfristig in KPIs ausdrücken – kippt die Stimmung. Dann werden Maßnahmen schnell als heiße Luft abgetan. Und die Folge? Ja, genau: HR verliert weiter an Glaubwürdigkeit. Und das in einer Zeit, in der sowieso immer noch dafür gekämpft wird, als gleichbürtige Partnerschaft behandelt zu werden.
In ganz klaren Worten ausgedrückt: Diversität sorgt tendenziell zuerst für Irritation, Konflikte und Widerstand. Das mag innerhalb des Teams passieren oder auch nur innerhalb des eigenen Kopfs, aber es findet statt. Und genau hier geben viele Unternehmen auf, in denen der Rückhalt von der Geschäftsführung ohnehin eher aus Gnade als Überzeugung gegeben wurde.
Biases blocken selbst den besten Business Case
Das Ganze wird noch heikler, wenn wir bedenken, wie Leistung überhaupt bewertet wird. Studien zur Zero Acquaintance Accuracy (Levesque & Kenny, 1993) zeigen: Menschen bilden sich schon nach Sekundenbruchteilen ein erstaunlich übereinstimmendes Bild über andere – auf Basis von Signalen wie Körpersprache, Stimme oder Gesichtsausdruck. Sasson et al. (2017) belegen, dass autistische Menschen allein aufgrund dieser „Thin Slice Judgments“ oft negativer bewertet werden – völlig unabhängig von tatsächlicher Kompetenz.
Mit anderen Worten: Selbst wenn Diversität objektiv die Performance steigert, kann sie subjektiv als „Leistungsrisiko“ wahrgenommen werden, wenn dominante Bewertungsmaßstäbe verzerrt sind. Bias kann also den Business Case neutralisieren, bevor er überhaupt zur Wirkung kommt.
Ethik, Moral und der Wert von Menschen
Bisher ging es also vor allem um die wirtschaftliche Sicht der Dinge, denn ich weiß aus meiner eigenen Arbeit: Menschen Chancen geben zu wollen und "nett" sein zu wollen, Inklusion bieten zu wollen, reicht in vielen Organisationen nicht aus. Gremien möchten Zahlen und Gewinn.
In der Diskussion um Neurodiversität wird vergeblich versucht, zwischen moralischer Verantwortung und wirtschaftlichem Nutzen zu trennen. Aber ehrlich gesagt funktioniert diese Trennung auch tatsächlich nicht, weil wir im Arbeitsalltag eben mit Menschen zusammenarbeiten. Gute Führungskräfte werden sie lieben, schlechte stöhnen auf: Menschen haben Moralverständnis, Überzeugungen und Motivationen. Und wenn Performance regelmäßig alles ist, was in einem Unternehmen zählt, sehen das alle Menschen – nicht nur diejenigen, die ihre Leistungsziele nicht erreicht und das Unternehmen verlassen haben.
Die rein utilitaristische Sicht ist also: Menschen dürfen da sein, solange ihre Bilanz positiv ist. Aber spätestens die Aufklärung rund um Neurodiversität konfrontiert uns mit der Tatsache, dass nicht jede Stärke in Tabellen messbar ist – und dass der eigentliche Mehrwert, wirtschaftlich und sozial, oft erst über längere Zeit, im Zusammenspiel oder in "soften" Faktoren erkennbar wird.
Man denke nur mal an das Thema "Personality Hire", das durchaus auch seine ernsthafte Basis hat, wie diese Studie betont.
Die Forschung rund um Organisationen macht die Wichtigkeit von sozialen Faktoren ebenso deutlich: Leistung entsteht nicht nur aus fachlicher Kompetenz, sondern auch aus Rahmenbedingungen. Maan et al. (2020) zeigen, dass wahrgenommene organisationale Unterstützung (Perceived Organizational Support) stark mit Jobzufriedenheit und Performance zusammenhängt – vermittelt über psychologische Empowerment-Prozesse. Shore et al. (2006) unterscheiden zwischen ökonomischem Austausch (Bezahlung gegen Leistung) und sozialem Austausch (gegenseitige Loyalität, Vertrauen, Unterstützung).
Der Business-Case* aber fokussiert sich allein auf den ökonomischen Teil – und lässt außen vor, dass soziale Bindungen der eigentliche Faktor sind, der Vielfalt überhaupt wirksam werden lässt. Wenn ein System nicht so gebaut ist, dass es Vielfalt aushält, zerbricht es an ihr. Und gleichzeitig wird so ein System nie zukunftsfähig sein, weil dieses Zerbrechen auch nur fehlende Kompetenzen in verschiedenen Bereichen offenlegt – Kompetenzen, die für Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit nötig sind, sobald Menschen miteinander zusammen arbeiten.
* Der Business-Case: "Diversity jetzt, Performance +40%, Profit!!! Superkräfte!! Die Außenseiter*innen haben auch Stärken!"
„Diversität hat doch aber Vorteile!“
Natürlich können und sollen wir uns über die positiven Effekte von Vielfalt freuen. Ist doch klasse, dass es nicht "nur" um Idealismus geht, sondern das Ganze wirklich von einer stabilen, wissenschaftlich nachweisbaren Basis gestützt wird. Aber eine gesamte Argumentation oder gar die komplette Daseinsberechtigung für Diversität darf nicht primär ökonomisch sein. Fakt ist: Chancengerechtigkeit und Teilhabe sind nicht verhandelbar, sondern ein Menschenrecht. Das bedeutet, dass schon allein aus global gesetzlicher Verpflichtung auch dann investiert werden muss, wenn der ROI nicht sofort sichtbar ist, wenn Innovationskurven flach starten oder ganz ausbleiben, oder wenn der erste Effekt eher in neuen Kompetenzen der Konfliktfähigkeit als in einem Umsatzplus bemerkbar wird.
Kurzum: Es gibt kein Erfolgsversprechen, das im Verkauf von Inklusion oder Neurodiversität mit absoluter Sicherheit genutzt werden kann, oder mit moralischem Handeln genutzt werden sollte. Vielfalt ist da. Vielfalt muss genutzt werden, oder ihr werdet abgehängt von denjenigen, die das sowieso schon machen, sich an den Reibungen weiterentwickeln und dann selbstverständlich auch die Vorteile vielfältiger Perspektiven mitnehmen und uns allen gut tun.
Die abgesenkte Bordsteinkante? Ursprünglich für Menschen im Rollstuhl, heute Erleichterung für alles mit Rädern. Dosenöffner? Gibt es, weil Konserven ihren Weg in ein neues, nicht-militärisches Publikum gefunden haben. Und die Aufbauanleitungen von IKEA, die damit eine ganz eigene Sprache vorgeben, stammen aus der Feder des dyslexischen Gründers.
Wer weiß, wo wir es als Gesellschaft und in jedem einzelnen Unternehmen hinschaffen, wenn wir Vielfalt nicht nur auf der Straße und im Privaten begegnen, sondern auch konsequent in unseren beruflichen Alltag integrieren.
Und wenn ihr das nächste Mal das Argument von x Prozent höherer Performance von diversen Teams seht... schickt doch mal kurz diesen Artikel rüber, damit wir Menschen nicht mehr in Prozenten messen 🥲
Habt's gut,
Vera