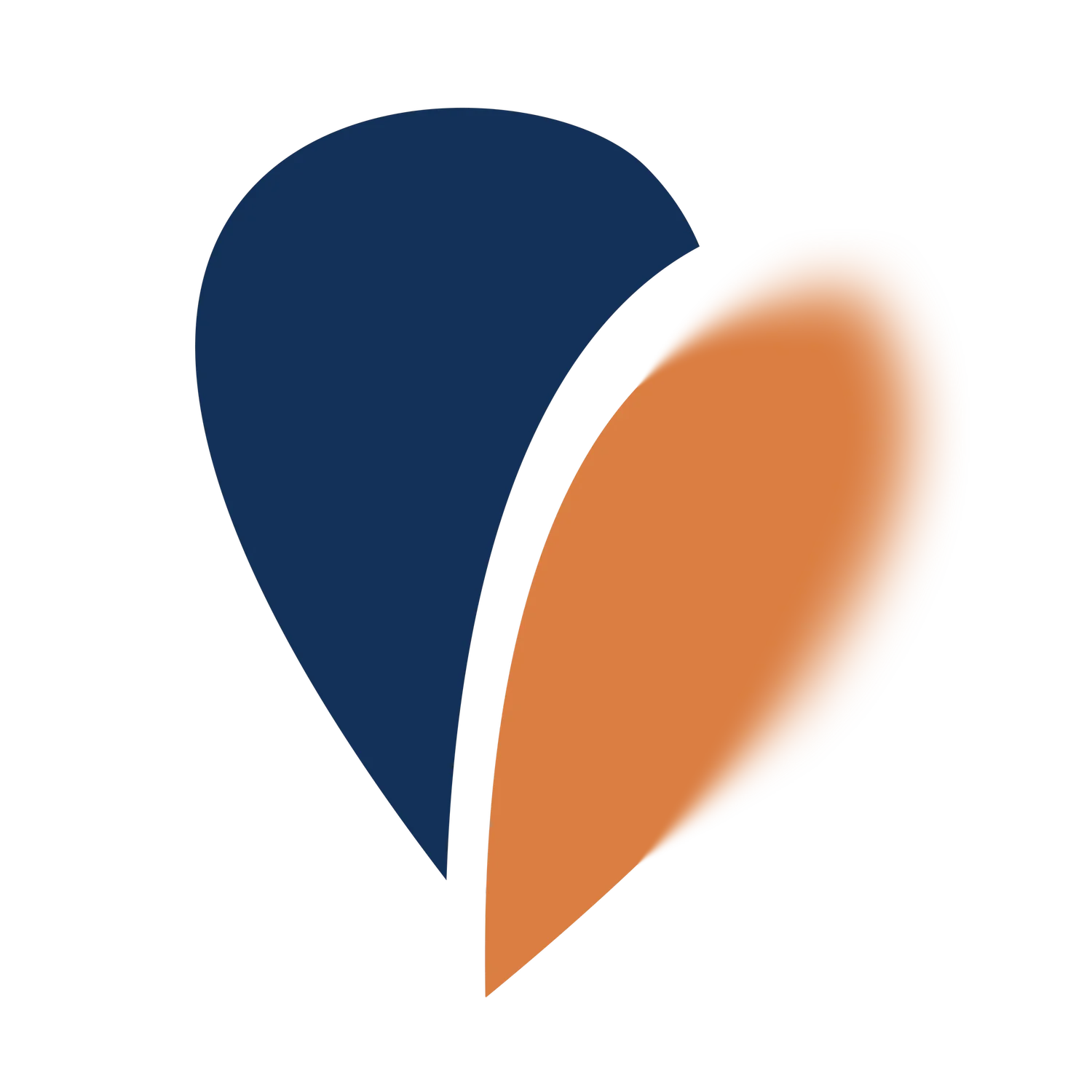Neurodivers oder neurodivergent?
Ursprünge und Unterschiede
-
Der Unterschied scheint erstmal klein, weil „neurodivers“ und „neurodivergent“ sich so ähnlich sind.
Es ist aber wichtig, die Begriffe zu unterscheiden, um über Minderheitenerfahrungen wertschätzend zu sprechen.Hier wird beides einmal übersichtlich und einfach erklärt.
Neurodiversität beschreibt die gesellschaftliche Vielfalt neurologischer Unterschiede – vergleichbar mit kultureller oder biologischer Diversität.
Neurodivergenz bezeichnet individuelle neurologische Unterschiede, die sich von der übrigen Mehrheit anderer Menschen unterscheiden.
Eine Person ist neurodivergent. Eine Gruppe ist neurodivers.
-
Neurodiversität bedeutet, dass menschliche Gehirne unterschiedlich und auf natürliche Weise verschieden arbeiten.
Ursprung des Begriffs Neurodiversität
Der Begriff wurde in den frühen 1990er-Jahren durch die aktivistisch arbeitende Person Jim Sinclair geprägt – auch wenn der Begriff später fälschlich der australischen Soziologin Judy Singer zugeschrieben wurde. Sie hat den Begriff aber in der Wissenschaft und Öffentlichkeit verbreitet.
Was gehört zu Neurodiversität?
Neurodiversität heißt also:
eine Gesellschaft besteht aus Menschen mit unterschiedlichen kognitiven, sensorischen und sozialen Verarbeitungsmustern.
diese Unterschiede sind nicht „falsch“ oder „zu therapieren“, sondern Teil menschlicher Vielfalt.
neurodivers ist keine Eigenschaft von Einzelpersonen, sondern von Gruppen. Eine Gruppe mit unterschiedlichen neurologischen Profilen ist neurodivers – eine einzelne Person ist es nicht.
Im Kontext von Organisationen bedeutet das: Teams bestehen immer aus einer Mischung unterschiedlich funktionierender Gehirne – unabhängig davon, ob Diagnosen vorliegen oder offen kommuniziert werden.
-
Neurodivergenz beschreibt eine individuelle neurologische Verarbeitung, die sich vom statistischen Durchschnitt – also von der neurotypischen Norm – unterscheidet.
Ursprung des Begriffs Neurodivergenz
Geprägt wurde der Begriff von der Aktivistin Kassiane Asasumasu, um eine Selbstbezeichnung jenseits pathologischer Kategorien zu ermöglichen.
Was gehört zu Neurodivergenz?
Typische Diagnosen, die Neurodivergenz zugeordnet sind:
Autismus
ADHS
Dyslexie, Dyskalkulie
Tourette-Syndrom
sensorische Verarbeitungsstörungen
kognitive Spätfolgen von Long COVID
neurologische Traumafolgen
Neurodivergenz ist kein medizinischer Begriff, sondern beschreibt Unterschiede, auch ohne Diagnose.
Es geht nicht um den klinischen Befund, sondern um die Tatsache, ob das eigene Gehirn in seiner Verarbeitung von anderen maßgeblich abweicht.
-
Mindestens 20 Prozent aller Menschen sind neurodivergent – das bedeutet: In jedem durchschnittlichen Team arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Verarbeitungsmustern.
Die Folgen, wenn das ignoriert wird:
Kommunikationsabbrüche und Konflikte im Team
Verlust von Potenzialen für Innovation, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit
Höhere Turnover-Rate, geringe Retention
Geringe psychologische Sicherheit im gesamten Team
Höhere Erschöpfung der Mitarbeitenden
Neurodivergenz ist unsichtbar und wirkt sich gleichzeitig auf sämtliche Aspekte der Zusammenarbeit aus. Einerseits natürlich für neurodivergente Menschen selbst, aber insbesondere auch auf die Teams und die Organisation als Ganzes.
Viele Betroffene wissen selbst nicht, dass sie neurodivergent sind. Oder sie wissen es, sprechen aber nicht darüber – aus Sorge vor Stigma oder Nachteilen.
Umso wichtiger ist es deshalb, Prozesse so zu gestalten, dass eine Diagnose oder Selbstoffenbarung nicht notwendig ist.
Klicke auf das + neben den Überschriften, um den Textinhalt anzuzeigen: