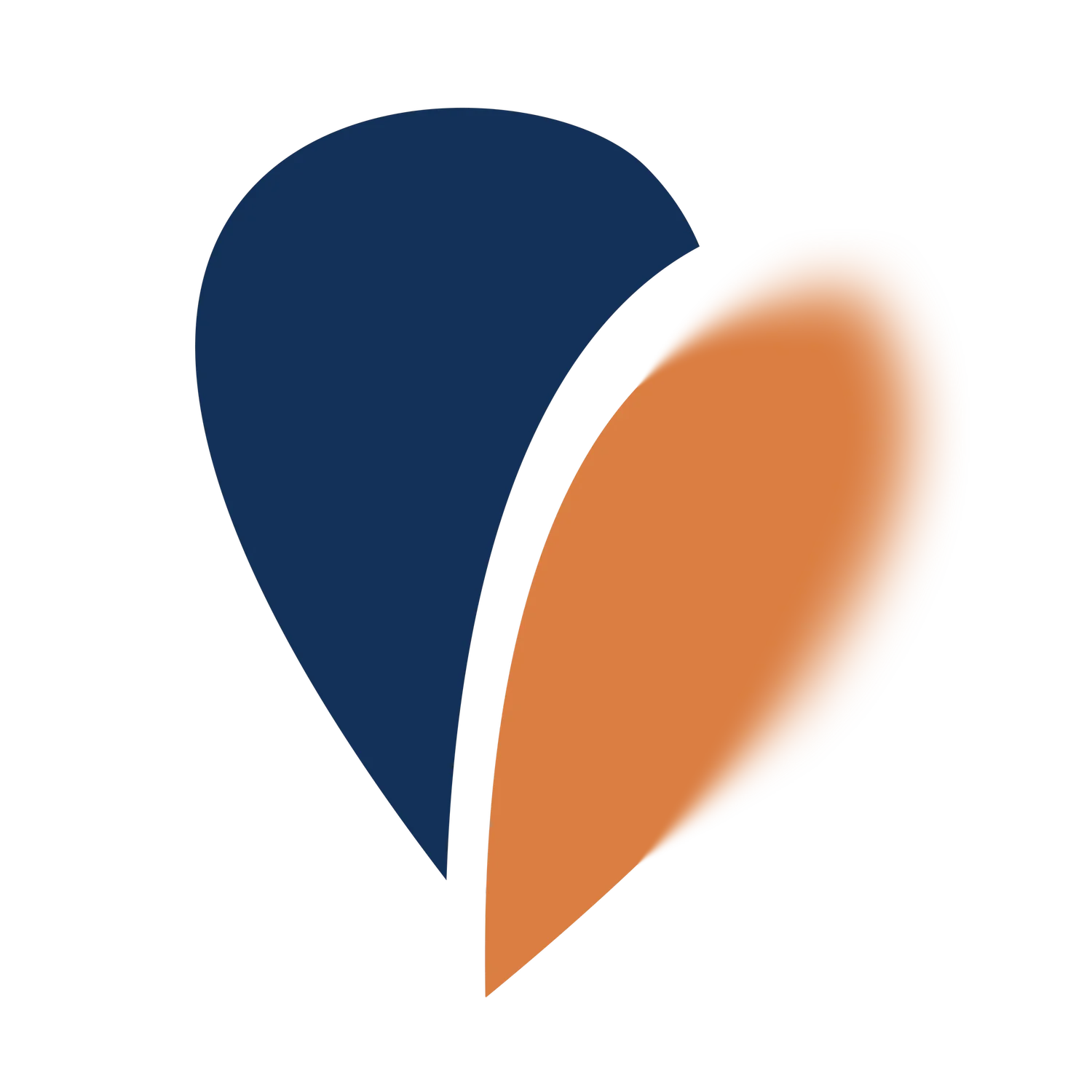Relevanz und Fehler von »Culture Fit« und »Culture Add«
Oh, der Culture Fit. So nachvollziehbar das Konzept ist, so sehr hindert es Unternehmen an Innovation und Vorankommen. Ich wage die steile These, dass beim Lesen eine Vielzahl an Gefühlen bei den Lesenden aufkommen wird – von Spott, Widerstand und Zweifel bis zu vollster Unterstützung und brodelnden, bestärkten Rebellionsambitionen.
Der Culture Fit in Organisationen rekonstruiert im Grunde etwas, was wir schon weitreichend auf gesellschaftlicher Ebene sehen: das buchstäbliche Zusammenpassen verschiedener Menschen. Und wer sich ein bisschen mit Effizienz, Innovation und Psychologie auseinandergesetzt hat, wird hoffentlich auch schon gelernt haben, dass wir als Menschen in verhängnisvollem Ausmaß nach Ähnlichem suchen. Sei es, dass in der Psychologie gesagt wird, wir suchen im Grunde immer unsere Elternteile in unseren Partner*innen, oder dass wir schon die Suchphrase in einer Google-Suche so formulieren, dass sie unsere bestehende Annahme bestätigt.
Culture Fit meint die Passung einer Person zur bestehenden Unternehmenskultur – oft basierend auf geteilten Werten, Verhaltensweisen und sozialen Codes.
Der Culture Fit funktioniert, weil Biases bedient werden. Aus der Innovationsforschung wissen wir, dass Biases absolutes Gift für Fortschritt sind. Soziologisch sind unbewusste Biases die Grundlage für Diskriminierung, Gewalt und Fehlentscheidungen mit verheerendem Ausmaß.
Wenn wir alle zusammenpassen, funktioniert alles besser – oder?
In vielen Organisationen wird sich so sehr auf das "Zusammenpassen" von Teammitgliedern konzentriert, dass das eigentliche Ziel dieser Passung völlig aus den Augen verloren wird – oder diese Passung vielleicht eigentlich gar nicht zu den Zielen der Organisation passt. Es betritt also den Raum: Der Culture Add.
Culture Add bezeichnet den Beitrag, den eine Person leisten kann, um die Kultur zu erweitern oder zu irritieren, zum Beispiel durch andere Perspektiven, Arbeitsweisen oder Erfahrungen.
Es ist klar, dass jede Änderung und Andersartigkeit ein System "irritiert", d.h. einen Impuls setzt, der das gesamte System um den Impuls herum beeinflusst. Wenn eine Organisation zum Beispiel Veränderung, Fortschritt oder gar Innovation zum Ziel hat, ist eigentlich selbsterklärend, dass es genau diese Impulse braucht.
Gleichzeitig setzt sich so ein System in unserem Kontext natürlich aus Menschen zusammen, für die ihrerseits jeder Impuls und jede Änderung biologisch erstmal Stress bedeutet. Das System muss also so gebaut sein, dass es Impulse und Veränderung überhaupt erst halten kann – und das funktioniert nur mit Diversifizierung und Prozessen, die einen stabilen Rahmen für Irritation bieten.
Angenommen, eine Organisation agiert seit Jahren mit den gleichen Prozessen und will sich weiterentwickeln. Wird in diesem Team zu sehr auf "Passung" geachtet, selbst wenn sich richtigerweise lediglich auf echte Werte konzentriert wird, verändert sich nichts. Auch reicht es nicht, nur eine Person als "Culture Add" statt Culture Fit einzustellen, weil diese sich sonst als Sinnbild für die unangenehme Veränderung mit einem festgefahrenen System konfrontiert sehen wird. Das gleiche aber gilt für Organisationen, die sich Innovation verschreiben: ist das gesamte System auf stete Veränderung und gegenseitiges Übertrumpfen ausgerichtet, entsteht dabei vor allem Instabilität, fehlende Verbindlichkeit und Kurzlebigkeit neuer Ideen.
Wie kommen wir also zum sicheren Culture Add?
Neben einer konstruktiven Fehlerkultur und der Unterstützung von Management und Geschäftsführung braucht es noch etwas mehr, damit es mit dem Culture Add klappen kann.
Wer den Culture Fit bzw. Add ernst nimmt, muss zuerst definieren, was genau passen soll und welchem Ziel das dient. Innovation? Aufgabenerledigung? Für das Teamverhalten? Für die Konfliktdynamik? Für das Entscheidungsverhalten? Ohne diese Differenzierung wird die Passung immer wieder auf Bauchgefühle zurückgehen – und das sind in diesem Kontext einfach nur strukturell diskriminierende Biases, keine guten Instinkte.
Wie gelangen Menschen überhaupt in den Bewerbungsprozess? Wird im Auswahlprozess tatsächliche Arbeitsfähigkeit entlang eines strukurierten Interviews bewertet oder vor allem das Auftreten, der Gesprächsfluss oder abermals: das eigene Gefühl?
Wer Flexibilität und Unterschiedlichkeit will, braucht erstmal Stabilität und Struktur, so konträr das auch klingt. Eine klare Rahmensetzung schützt nicht nur neurodivergente Teammitglieder, sondern das ganze System. Sie macht Prozesse vorhersehbar, einschätzbar und verbindlich für alle.
Der Raum für Konflikte muss geschaffen und dann auch aktiv aufgesucht werden. Gibt es im Unternehmen Möglichkeiten und erwartbare Outcomes, Konflikte anzustoßen oder Meinungsverschiedenheiten zu äußern? Wissen alle, wo der Unterschied zwischen einer Meinung und Diskriminierung liegt? Beides ist wichtig, denn: Konflikte verstärken auch bestehende Machtdynamiken.
Spätestens jetzt wird vielleicht auch etwas klarer, wie selten diese Themen wirklich systematisch bearbeitet werden... und wie viele Ressourcen Organisationen dadurch auf die Lösung von Konflikten, das immer neue Erarbeiten von Best Practices und Schulungen aufwenden.
Ein paar dieser Themen werden auch in meinem Buch "Neurodiversität in Unternehmen" angesprochen. Ich habe eine Warteliste eingerichtet, damit du benachrichtigt wirst, sobald es erhältlich ist. Wenn du magst, trag dich gern hier in die Warteliste ein.
Und in jedem Fall: Bleibt dran, denn in der nächsten Ausgabe wird es wieder spannend!
Bis zum nächsten Mal!
Vera