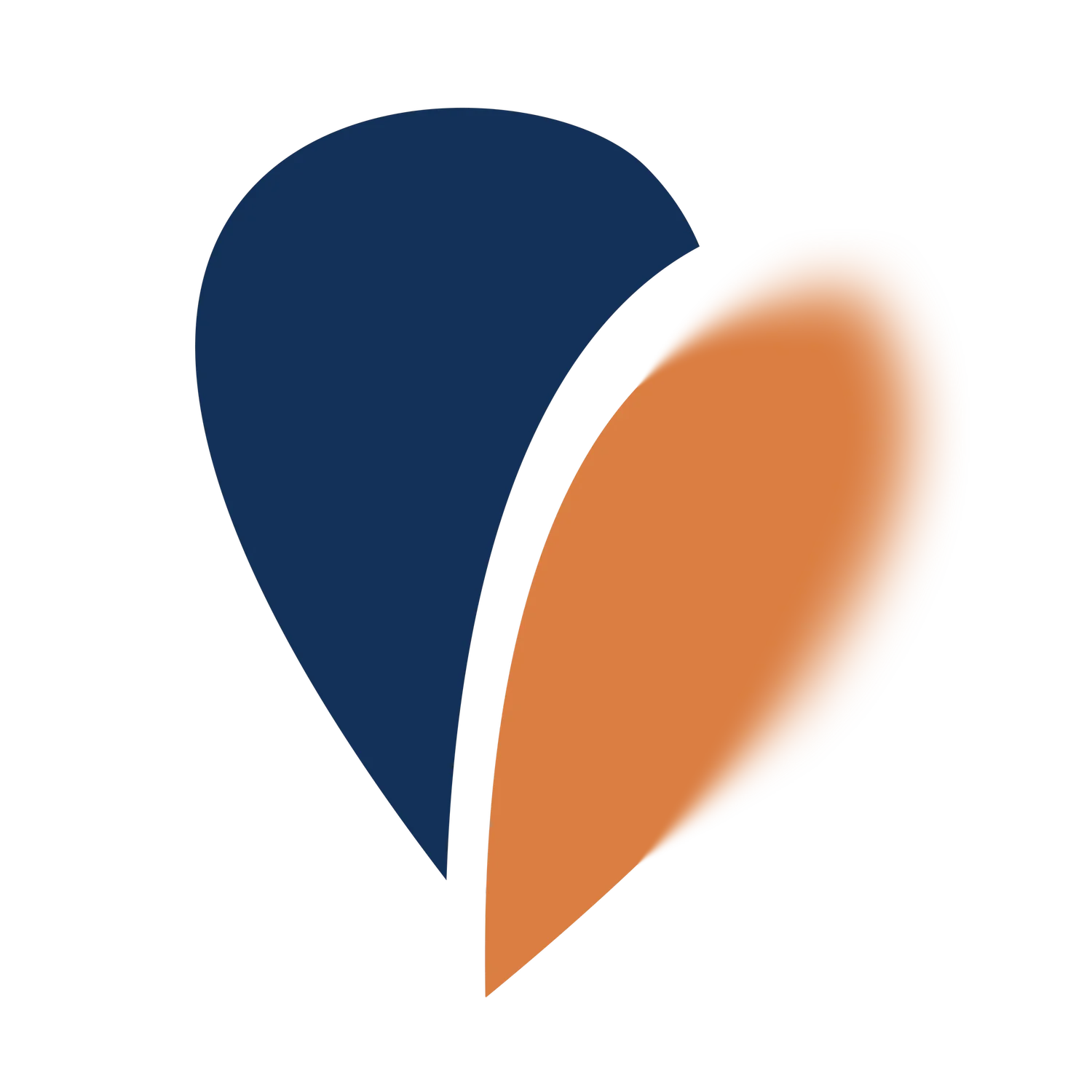Warum wir über Neurodiversität sprechen müssen
Hallo und schön, dass du da bist!
Ich freue mich, dass du hier zu meinem ersten Newsletter gelandet bist. Die Begriffe von Neurodiversität, Neurodivergenz, Inklusion, Mental Health und viele weitere werden auch im Arbeitskontext immer wichtiger. Wir wissen mehr darüber, wie Menschen produktiv arbeiten, wie wir Innovation schaffen, wie wir miteinander eine Arbeitswelt für alle schaffen. Heute erkläre ich erstmal ein paar Grundlagen und worum es in diesem Newsletter gehen wird. In Zukunft werden die Inhalte stärkeren Praxisbezug haben.
Hintergrund ist nämlich: Ich schreibe aktuell ein Handbuch, das dieses Jahr bei Springer Gabler erscheinen wird 🎉 Das Buch wird Menschen in der Personalarbeit, C-Level, Leadership und natürlich auch selbst neurodivergente Menschen dabei unterstützen, effektivere Prozesse aufzusetzen, besser zusammen zu arbeiten und sich gegenseitig besser zu verstehen. Dieser Newsletter begleitet aber nicht nur die Entstehung meines Buchs, sondern ist auch ein Ort, an dem wir uns schon vor Veröffentlichung gemeinsam damit beschäftigen können, was Organisationen tun können, dass sie auch die Stärken von neurodivergenten Menschen richtig nutzen.
Weil ehrlich gesagt: Das tun sie oft nicht. Und hindern sich damit am eigenen Fortschritt.
Neurodivergenz und Neurodiversität: Zwei Begriffe für zwei Konzepte.
Mindestens 20 Prozent aller Menschen sind neurodivergent. Das heißt: Ihr Gehirn funktioniert anders als das der Mehrheit anderer Menschen, deren Gehirne deshalb als "neurotypisch" bezeichnet werden. Mit dem Begriff werden häufig auch bestimmte Diagnosen in Verbindung gebracht, zum Beispiel Autismus, ADHS, Lernbesonderheiten oder Hochbegabung, aber auch Persönlichkeitsstörungen, Alzheimer und andere neurologische Unterschiede, zu denen schon länger geforscht wird. Dieser Begriff der "Neurodivergenz" ist recht neu und wurde erst circa im Jahr 2000 von Kassiane Asasumasu erstmals eingeführt.
"Neurodiversität" dagegen beschreibt die Gesamtheit der neurologischen Vielfalt, also die Gesamtheit von sowohl neurotypischen als auch neurodivergenten Gehirnstrukturen. Die Einführung dieses Konzepts wird gängigerweise einer australischen Soziologin names Judy Singer im Jahr 1998 zugeschrieben – allerdings stammt das Konzept tatsächlich von einer anderen Person, die das Autism Network International (ANI) gründete: Jim Sinclair. Sinclair schreibt bereits 1993 das Essay "Don't Mourn for Us" und ist damit zum aktuellen Wissensstand die erste Person, die sich dem bisher "krankhaften" Blick auf Autismus mit dem Konzept von Neurodiversität entgegenstellte, auch wenn der Begriff nicht exakt so genutzt wurde. Das Konzept selbst war und ist auch heute noch für viele Menschen sehr neu und ungewohnt.
Neurodiversität ist überall, nur nicht überall auf der Agenda.
Durch die lange Stigmatisierung des "Andersseins" und verinnerlichte Konzepte wie Ableismus sind nicht alle Menschen bereit (und ist es nicht für alle Menschen sicher!), anderen ihre eigene Neurodivergenz mitzuteilen. Viele Menschen wissen auch selbst gar nicht, dass sie neurodivergent sind – das ist völlig in Ordnung, und bedeutet aber häufig gleichzeitig, dass wieder und wieder scheinbar unerklärliche, ähnliche Konflikte aufkommen, soziale Beziehungen scheitern, Ziele nicht erreicht werden.
Erinnern wir uns an die Zahl von 20 Prozent aller Menschen, die nicht neurotypisch sind: statistisch ist in jedem Team mit fünf Personen auch eine Person, die Zusammenhänge anders versteht, Reize anders verarbeitet, grundlegend anders fühlt, denkt und urteilt. In Systemen, die auf Einheitlichkeit und Gleichheit ausgerichtet sind, kommen die Vorteile dieser anderen Perspektive nicht zur Geltung, sondern werden oft zum Hindernis – während gleichzeitig global die Wichtigkeit von Innovation und neuen Lösungen für Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit betont wird.
Ganz gleich, ob gewollt oder nicht: unsere Organisationen sind längst neurodivers, und es ist an der Zeit, dass neurodivergente Menschen sich voll einbringen dürfen.
Und jetzt?
Ich arbeite gerade an einem Buch, das genau dort ansetzt. Meine Ansätze dabei sind Sachlichkeit und Zielorientierung, nicht persönliche Vorlieben oder Ideale. Es geht auch nicht um Besser, Schlechter, oder magische "Superpower", die mit Menschlichkeit und Alltag nichts zu tun haben. Stattdessen biete ich auf rund 250 Seiten einen praktischen, wissenschaftlich fundierten und ehrlichen Blick auf Organisationen und was sie – wir – tun können, um neurodivergente Menschen nicht nur mitzudenken, sondern damit wir endlich gemeinsam gestalten.
Hier im Newsletter nehme ich dich mit auf dem Weg dorthin. Jeden Monat teile ich:
Einen Einblick in den Entstehungsprozess des Buchs
Praxisbeispiele, Perspektiven und Mini-Exkurse
Und manchmal auch einen kleinen Rant, wenn's nötig ist, sonst wär's ja nicht mein Newsletter 😉
Wer also mit möchte auf diese Reise: folg einfach dem Newsletter! So erfährst du auch, sobald das Erscheinungsdatum des Buchs feststeht – und auch, ob es vielleicht gegen Mitte des Jahres eine Verlosung von Freiexemplaren unter den Abonnent*innen geben wird... 👀 🫶
(Und wenn du willst, dass mehr Menschen das Thema auf dem Radar haben, leite den Newsletter gern weiter!)
Bis bald – ich freu mich auf den Austausch!
Vera