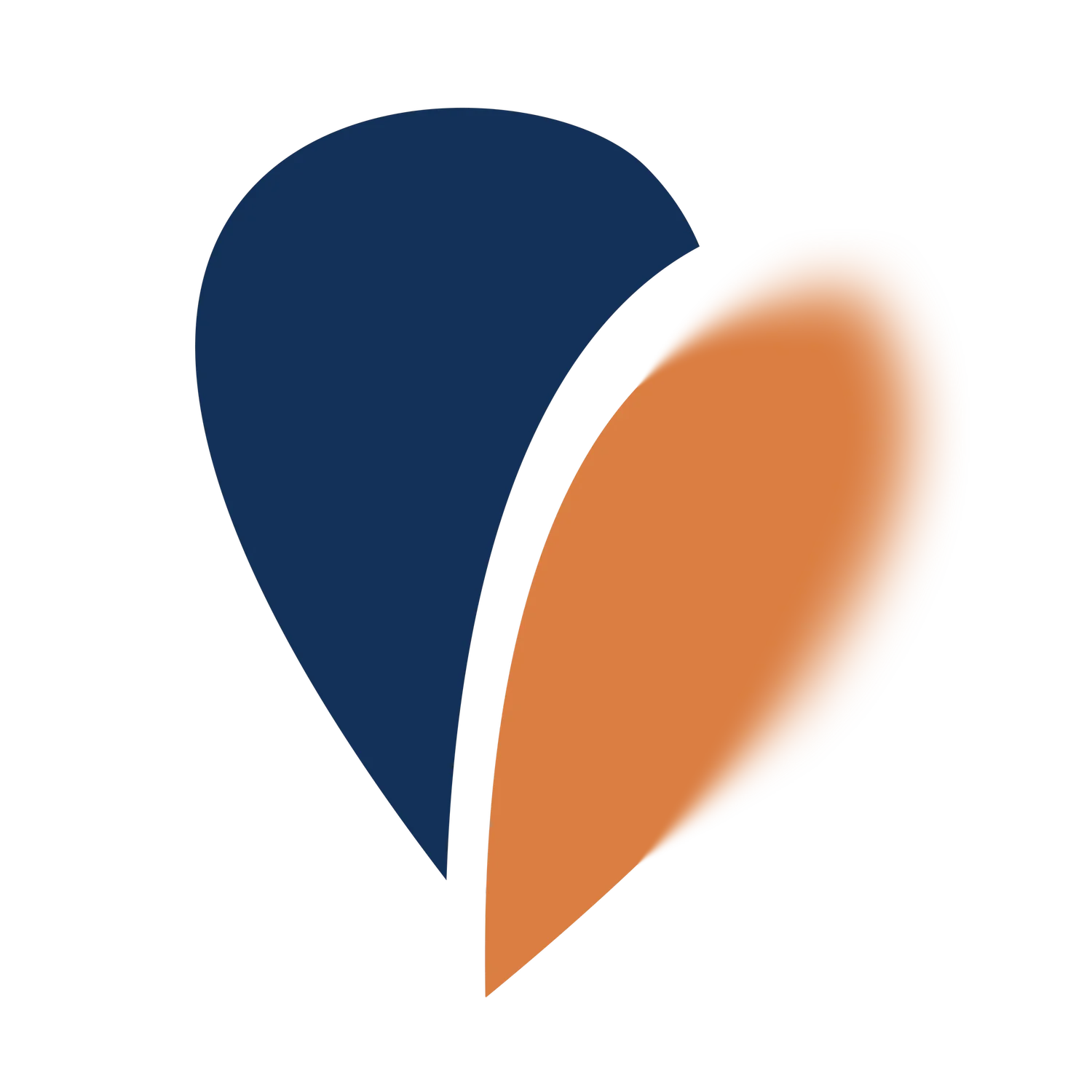Warum es keine (seriösen) Standardlösungen für Neuroinklusion gibt
Hallo und willkommen zurück – oder zum ersten Mal dabei!
In der ersten Ausgabe dieses Newsletters habe ich erklärt, worum es hier gehen wird und dir einmal die Basics zu Neurodiversität und Neurodivergenz erklärt. Heute gibt’s ein großes Update: Mitte Mai ist mein Manuskript an das Lektorat bei Springer gegangen! 🎉
Nun stehen noch letzte formale Anpassungen an. Seit ich mein Manuskript das letzte Mal vor Augen hatte, ist nun ein Monat vergangen und ich stehe vor einer neuen Herausforderung: Ich sehe jetzt beim Überarbeiten erst, wie viel mehr ich eigentlich noch sagen und Organisationen mitgeben wollte und nicht kann.
Individuelles Erleben oder standardisierte Lösungen?
Schon beim ursprünglichen Schreibprozess hatte ich Schwierigkeiten damit, eine Grenze zwischen meinen persönlichen Erfahrungen und meiner Rolle als fachliche Expertin zu ziehen. Ich bin neurodivergent, bin mehrfach marginalisiert und habe genau solche Erfahrungen, die mir meine Arbeit in diesem so jungen Feld ermöglichen. Gleichzeitig bin ich kompetent in meiner Arbeit und weiß, dass persönliche Anekdoten vielleicht Empathie auslösen, nicht aber fundierte Lösungen erzeugen. Wie bekomme ich also all das in ein einziges Buch, das so vielen Menschen unterschiedlichster Perspektiven weiterhelfen soll? Und die Antwort ist: Gar nicht, weil es an diesem Punkt nicht nötig ist.
Das Buch wird das erste (!) deutschsprachige Grundlagenwerk rund um Neuroinklusion und neurodiverse Zusammenarbeit für Menschen in der Personalarbeit, im Management, in jeglicher Organisation. Es wird ein Startpunkt für den deutschen Arbeitsmarkt, der für sich erst langsam versteht, dass Neurodiversität nicht mit Betriebssystemen oder Comic-Serien verglichen werden kann, sondern sich bereits jetzt real und facettenreich im Alltag abspielt. Ein gedankliches Framework dafür, wo Veränderung möglich ist und sein muss, um dann eine Begleitung durch Erfahrungsexpert*innen mit fachlicher Expertise noch so viel gewinnbringender für alle zu gestalten, weil nicht erst bei Null angefangen werden muss.
Neuroinklusion lässt sich aber nicht wie ein Template einbauen. Je nach Branche, Teamgröße, Kommunikationsstil, Führungsverständnis usw. braucht es ganz unterschiedliche Strategien und auch völlig andere Fragen. Kurz: Die Realität der eigenen Organisation bestimmt, welche Probleme überhaupt durch Standardlösungen behoben werden können, und welche Lösungen dagegen grundlegende, weitreichende Veränderungen voraussetzen würden. Und ja, das ist total frustrierend, wenn mir klar ist, dass nunmal ein Fünftel aller Menschen neurodivergent ist und die Auseinandersetzung damit unweigerlich in der eigenen Organisation kommen muss, aber eben auch einiges an Arbeit mit sich bringen wird. Aber es ist nötig und lohnt sich als Projekt, das sich über Jahre hinweg ziehen wird, und in dem wir alle immer weiter dazulernen und besser zusammenarbeiten werden.
Ein Beispiel: In einem ersten Workshop für eine neue Teamkultur sollen alle offen über ihre Arbeitsbedürfnisse sprechen. Klingt soweit ganz schön – aber neurodivergente Mitarbeitende, die ihre Diagnose nie offengelegt haben, fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt, sich nun zu outen, weil ihre Bedürfnisse veränderte Prozesse für die gesamte Organisation bedeuten würden und das Diskussionen auslöst.
Was als allgemeine Lösung und "was braucht ihr, um gut zu arbeiten?" gut gemeint ist, funktioniert oft nicht bis in die Details, wenn Neurodivergenz nicht mitgedacht wird. Stattdessen gibt es auch bei dieser vermeintlich offenen Frage bestimmte Grenzen, welche Bedürfnisse ohne zusätzliche Scheine und Selbstoffenbarungen akzeptabel sind und welche nicht. Das heißt, die eigentlichen Ursachen geringer Performance, regelmäßiger Konflikte oder einer baldigen Kündigung werden gar nicht erst bekannt, wenn Neuroinklusion nur auf die Personen angewandt werden soll, deren Diagnose der HR-Abteilung bekannt ist. Und trotzdem werden diese Probleme immer wieder auftreten – es sei denn, eine Organisation ist wirklich als Ganzes veränderungsbereit. Das trifft schlicht nicht auf alle Organisationen zu, und das ist auch in Ordnung und eine Realität, der sich Beteiligte bewusst sein sollten, wenn praktische Lösungen gefunden werden sollen. Allerdings zeigt das, dass die Lösungen für solche Probleme nur individuell in jedem Team und jeder Organisation erarbeitet werden können.
Wir sind Menschen, keine Geschichten
Viele Stimmen im Bereich Neurodiversität setzen ausschließlich auf ihre persönliche Geschichten. Das ist verständlich, berührend und ich bin so unendich froh und dankbar, dass wir immer mehr werden, dass wir privilegiert genug sind, unsere Neurodivergenz offen thematisieren zu können, und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Persönliche Geschichten machen das Thema greifbarer und sichtbar und sie zeigen, dass es uns alle wirklich gibt.
Aber: Was im Marketing für die Personal Brand gut funktioniert, reicht für praktische Veränderung noch nicht aus. Persönliche Erfahrung allein beantwortet keine strukturellen Fragen und sagt viel über mich als Einzelperson aus, nichts aber über mein Gegenüber oder die Probleme, die vielleicht gerade wöchentlich im eigenen Team laut werden. Unsere Geschichten können Perspektiven eröffnen – nicht aber Prozesse verändern. Und Bedürfnisse sollten nicht erst dann ernstgenommen werden, wenn Menschen ihre Leidensgeschichte mit anderen Personen geteilt haben, an die sie in erster Linie durch einen Arbeitsvertrag gebunden sind.
Deshalb ein Disclaimer an euch und ein Mantra an mich: Das Buch wird fundiertes Wissen, praxisnahe Hinweise und viele konkrete Beispiele liefern – aber was danach passiert, muss individuell sein. Ob durch interne Reflexion, durch Austausch, durch Beratung oder Coaching.
Wenn du magst, teile gern den Newsletter oder schreib mir, wenn du ein konkretes Thema vertiefen möchtest. Und: Ich halte dich hier auf dem Laufenden – auch, was das Erscheinungsdatum betrifft 👀
Bis bald und vielen Dank für's Mitlesen!